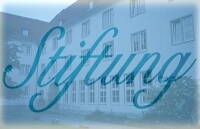 Bildrechte: Puppel
Bildrechte: PuppelStiftungsrecht
Kurzer Überblick über das Stiftungsrecht
Die grundlegenden Bestimmungen zum Stiftungsrecht sind in den §§ 80 - 88 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) enthalten.
Das Niedersächsische Stiftungsgesetz (NStiftG) vom 11.10.2023 (Nds. GVBl. S. 250) regelt im Wesentlichen die Zuständigkeiten der Stiftungsbehörden und konkretisiert die bestehenden Befugnisse der Stiftungsaufsicht unter den Rahmenbedingungen des neugeregelten materiellen Stiftungsrechts im BGB.
Was ist eine "Stiftung"?
Der Begriff "Stiftung" an sich ist nicht gesetzlich festgelegt. Es kann sich im allgemeinen Sprachgebrauch um eine rechtsfähige, aber auch um eine nicht rechtsfähige Stiftung handeln. Die Schenkung eines Vermögensgegenstandes kann so bezeichnet sein. Stiftungen findet man auch in der namentlichen Bezeichnung anderer Rechtsformen (etwa eingetragener Vereine, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften, Stiftungen des öffentlichen Rechts, aber ggf. auch Stiftungen ausländischen Rechts ohne Sitz in Deutschland).
Nicht rechtsfähige Stiftungen sind im BGB nur indirekt geregelt, etwa als Auftrag, als Schenkung unter Auflagen oder als Vermächtnis unter Auflagen. Das Vermögen ist entweder dem Auftraggeber oder etwa dem Beschenkten eigentumsrechtlich zuzuordnen. Eine staatliche Stiftungsaufsicht mit ihrer Funktion der dauernden Gewährleistung des Stifterwillens findet nicht statt.
Der Anwendungsbereich des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes beschränkt sich allein auf rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts.
Was ist eine rechtsfähige Stiftung?
Eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts ist eine auf Dauer zugewendete und verselbständigte Vermögensmasse, deren Ertrag mindestens einem bestimmten Zweck dient.
Welche Stiftungszwecke sind möglich?
Der Stiftungszweck ist zentraler Bestandteil des Stifterwillens und gewissermaßen das Herzstück jeder Stiftung. Durch den Grundsatz der Stiftungsfreiheit sind den schöpferischen Gestaltungsmöglichkeiten der Stifterin oder des Stifters kaum Grenzen gesetzt.
Die Grenzen finden sich insbesondere in der Gefährdung des Gemeinwohls und - bei gemeinnützigen Stiftungen - in den §§ 51 ff. der Abgabenordnung. Zulässig sind insbesondere Stiftungen, die als steuerbegünstigt anerkannte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung verfolgen. Aber auch darüber hinaus sind Stiftungen zulässig, bei denen das Stiftungsgeschäft den Anforderungen des § 81 BGB genügt und die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert erscheint.
Der Stiftungszweck sollte sehr sorgfältig formuliert werden. Einerseits sollte er so konkret gefasst sein, dass Rechtsunsicherheit und Fehlinterpretationen, insbesondere nach dem Ableben des Stifters, vermieden werden. Andererseits sollte er nicht zu eng formuliert werden, so dass genügend Spielraum für eine sinnvolle Zweckerfüllung auch unter veränderten Bedingungen bleibt.
Auch sollte bei der Abfassung der Stiftungssatzung geprüft werden, ob den Stiftungsorganen Beschlüsse über die Änderung der Satzung und ggf. auch über die Aufhebung sowie die Zulegung zu oder die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung zugestanden werden sollen.
Wer kann stiften?
Jede unbeschränkt geschäftsfähige natürliche oder jede juristische Person kann eine Stiftung errichten. Bei nicht rechtsfähigen - da nicht eingetragenen - Vereinen (vgl. § 54 BGB) hat sich in der Literatur und der Rechtssprechung zwischenzeitlich die Auffassung durchgesetzt, dass auch dort von einer "Stifterfähigkeit" ausgegangen werden kann, wenn durch geeignete Mittel im erforderlichen Umfange insbesondere das Bestehen des Vereines und die Vertretungsberechtigung der handelnden Personen nachgewiesen wird.
Wie wird gestiftet? Warum gibt es die Stiftungsaufsicht?
Es sind Errichtungen unter Lebenden oder auch in einem Testament möglich. Neben dem sogenannten Stiftungsgeschäft ist die staatliche Anerkennung der Rechtsfähigkeit erforderlich. Zuständig dafür ist in Niedersachsen die Stiftungsbehörde. Bei kirchlichen Stiftungen erfolgt die Anerkennung im Einvernehmen mit der Kirchenbehörde.
Die Stiftungsaufsicht des Landes stellt sicher, dass die Stiftungen im Einklang mit den Gesetzen und der Stiftungsverfassung verwaltet werden. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass Entschlusskraft und Verantwortungsfreudigkeit der Mitglieder der Stiftungsorgane nicht beeinträchtigt werden. Sie gewährleistet, dass der Wille der oder des Stiftenden dauerhaft eingehalten oder nicht mehr als notwendig verändert wird.
Was ist das Stiftungsgeschäft?
Das Stiftungsgeschäft ist die einseitige Willenserklärung eines oder mehrerer Stiftenden, mit einem bestimmten Vermögen und zu einem bestimmten Zweck eine rechtsfähige Stiftung zu errichten.
Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf nach § 81 Abs. 3 BGB der schriftlichen Form. Es muss die verbindliche Erklärung der Stifterin oder des Stifters enthalten, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihr oder ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen.
Im Stiftungsgeschäft muss der Stifter
1. der Stiftung eine Satzung geben, die mindestens Bestimmungen enthalten muss über
a) den Zweck der Stiftung
b) den Namen der Stiftung
c) den Sitz der Stiftung
d) die Bildung des Vorstands der Stiftung, sowie
2. zur Erfüllung des von ihm vorgegebenen Stiftungszwecks ein Vermögen widmen (gewidmetes Vermögen),
das der Stiftung zu deren eigener Verfügung zu überlassen ist.
Was wird in der Satzung geregelt?
Der Mindestinhalt der Stiftungssatzung ergibt sich aus § 81 Absatz 1 Nr. 1 BGB (s.o.). Weitergehende und wünschenswerte Anforderungen an die Stiftungssatzung können nur im Beratungswege empfohlen werden. Die Anerkennung kann nicht von der Erfüllung solcher Anforderungen abhängig gemacht werden.
Derartige Inhalte sind z.B.:
- etwaige weitere Organe der Stiftung
- Anzahl, Berufung, Amtsdauer und Abberufung der Organmitglieder
- Geschäftsbereich und Vertretungsmacht der Stiftungsorgane
- Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung der Stiftungsorgane
- Beurkundung von Beschlüssen der Stiftungsorgane
- etwaige Rechte derer, die durch die Stiftung bedacht sind
- mögliche Erhöhung des Stiftungsvermögens bzw. Rücklagenbildung
- Auslagenersatz oder Aufwandsentschädigungen der Organmitglieder
- mögliche Anpassung oder Änderung der Satzung, insbesondere des Zweckes
- Zulässigkeit der Aufhebung sowie der Zulegung zu oder der Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung
- Vermögensanfall nach evtl. Auflösung der Stiftung
Nach Möglichkeit soll nicht eine Person allein für die Stiftung vertretungsberechtigt sein.
Steuerliche Überlegungen
Eine Stiftung genießt Steuervergünstigungen, wenn sie nach Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient (Einzelheiten ergeben sich aus den §§ 51 - 68 der Abgabenordnung). Um den dortigen Anforderungen zu entsprechen, kann es erforderlich sein, die Stiftungssatzung den Vorgaben der Abgabenordnung anzupassen.
Auch für die Kapitalausstattung einer gemeinnützigen Stiftung bzw. für Spenden und Zuwendungen an eine solche Stiftung können Steuervergünstigungen in Betracht kommen.
Die Stiftung darf für den Unterhalt des Stifters und seiner nächsten Angehörigen sowie für die Pflege des Stiftergrabes bis zu einem Drittel ihres Einkommens verwenden, ohne ihre Gemeinnützigkeit zu gefährden (§ 58 Nr. 6 Abgabenordnung).
Alle steuerlichen Gesichtspunkte einer Stiftungserrichtung können verbindlich ausschließlich mit der Finanzverwaltung abgeklärt werden. Die Stiftungsbehörden haben insoweit keinerlei Zuständigkeiten.
Welche Behörde ist für die Anerkennung zuständig?
Für die Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Stiftung nach § 80 BGB ist die Stiftungsbehörde zuständig. In Niedersachsen ist dies seit dem 1. Juli 2014 das jeweils örtlich für den - vorgesehenen - Sitz der Stiftung zuständige Amt für regionale Landesentwicklung.
Was ist im Verfahren zur Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Stiftung weiter zu beachten?
Nach Art 80 Abs. 1 BGB muss zur Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer Stiftung die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes gesichert erscheinen. Voraussetzung hierfür ist ein ausreichendes Stiftungsvermögen. Es ist nicht erforderlich, dass das für den erstrebten Zweck benötigte Stiftungsvermögen im Zeitpunkt der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Stiftung bereits vorhanden ist. Es genügt, wenn mit Sicherheit zu erwarten ist (etwa durch verbindliche Zusagen), dass das Vermögen den vollen Betrag in absehbarer Zeit durch Zustiftungen, Spenden oder Sammlungen erreicht. Dagegen ist es nicht ausreichend, wenn für den vollen Betrag erst Vermögenserträge angespart werden müssen. Das Vermögen kann auch in einem - verbindlich festgelegten - Recht auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen bestehen.
Ein Mindestkapital für das Stiftungsvermögen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Im Rahmen der von der Stiftungsbehörde vor der Anerkennung der Rechtsfähigkeit vorzunehmenden Prüfung, ob die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes gesichert erscheint, kann das Vorliegen dieser Voraussetzung grundsätzlich nur dann bejaht werden, wenn das Stiftungsvermögen zu den beabsichtigten Stiftungszwecken in einem angemessenen, ausreichenden Verhältnis steht. Da die Stiftungszwecke nicht durch das Stiftungskapital selbst, sondern nur durch dessen Erträge (und weiteren Einnahmen wie z.B. Spenden) erfüllt werden dürfen, ist angesichts der derzeitigen Lage auf dem Kapitalmarkt ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, inwieweit mit dem vorgesehenen Stiftungsvermögen ausreichende Erträge erzielt werden können. Daneben können auch andere in der vorgesehenen Art der Zweckerfüllung liegenden Besonderheiten berücksichtigt werden. Bei einer zu geringen Vermögensausstattung sollte auch geprüft werden, ob andere Möglichkeiten der Zweckverwirklichung in Betracht kommen (etwa eine nicht rechtsfähige Stiftung oder eine Zustiftung zu einer bestehenden Stiftung) oder die Anpassung des Umfangs der in der Satzung vorgesehenen Stiftungszwecke denkbar ist.
Können aus dem vorgesehenen Stiftungsvermögen - etwa Kunstwerke - keine Erträge oder sonstige Einnahmen (etwa Zinsen, Mieteinnahmen, Nutzungsentgelte, Lizenzgebühren) erzielt werden, so sind neben derartigen Vermögensbestandteilen in aller Regel noch ertragbringende Vermögensgegenstände (etwa Bankkonten oder Wertpapiere) zu fordern, um den Grundbedarf der Zweckerfüllung zu gewährleisten.
Es bietet sich an, Entwürfe von Stiftungsgeschäft und Satzung sowie eventuell ergänzende Informationen vorab mit der Stiftungsbehörde abzustimmen.
Dem Antrag auf Anerkennung der Rechtsfähigkeit einer errichteten Stiftung sind in der Regel folgende Unterlagen beizufügen:
- Stiftungsgeschäft und Satzung im Original und nach Möglichkeit zweifach
- bei juristischen Personen Nachweis der Vertretungsbefugnis (z.B. durch beglaubigte Auszüge aus Handels- oder Vereinsregister)
- ggf. Stellungnahme bzw. vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes
- ggf. Vollmachten
- ggf. Einverständniserklärungen berufener Organmitglieder
Welche Änderungen ergeben sich für Verbrauchstiftungen?
Das Stiftungswesen wird dadurch geprägt, dass Stiftungen auf Dauer zur Erfüllung bestimmter Zwecke errichtet werden. Sie kann nach § 80 Abs. 1 Satz 2 BGB aber auch auf bestimmte Zeit errichtet werden, innerhalb derer ihr gesamtes Vermögen zur Erfüllung ihres Zweckes zu verbrauchen ist (Verbrauchsstiftung). Nach § 82 Satz 2 BGB erscheint die dauernde Erfüllung des Stiftungszwecks bei einer Verbrauchsstiftung als gesichert, wenn die in der Satzung für die Stiftung bestimmte Zeit mindestens zehn Jahre umfasst.
Soweit eine Mindestdauer von 10 Jahren im Stiftungsgeschäft oder der Stiftungssatzung vorsehen ist, kann die Dauerhaftigkeit vermutet werden. Hierbei ist entweder eine Zeit- oder Datumsangabe möglich, aber auch ein inhaltlich definierter Endzeitpunkt – wie etwa die Fertigstellung eines Bauwerkes. Entscheidend ist, dass – im Gegensatz zu der herkömmlichen Stiftung – die „Endlichkeit“ der Stiftung nicht in Frage gestellt wird.
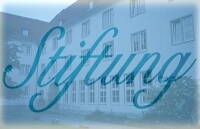 Bildrechte: Puppel
Bildrechte: PuppelStiftungen haben sich die Erfüllung verschiedenster Aufgaben zum Ziel gesetzt, z.B. den Betrieb eines Alten- und Pflegeheims.
- Überblick über das Stiftungsrecht
- §§ 80 - 88 BGB ( > BMJ)
- Niedersächsisches Stiftungsgesetz (NStiftG)
- Stiftungsverzeichnis
- Übersicht über die vom Land errichteten oder verwalteten Stiftungen
- Anschriften der Stiftungsbehörden und anderer Institutionen
- Beispiele / Muster für Stiftungsgeschäft und -satzung
- steuerrechtliche Informationen der OFD Hannover zur Gemeinnützigkeit


